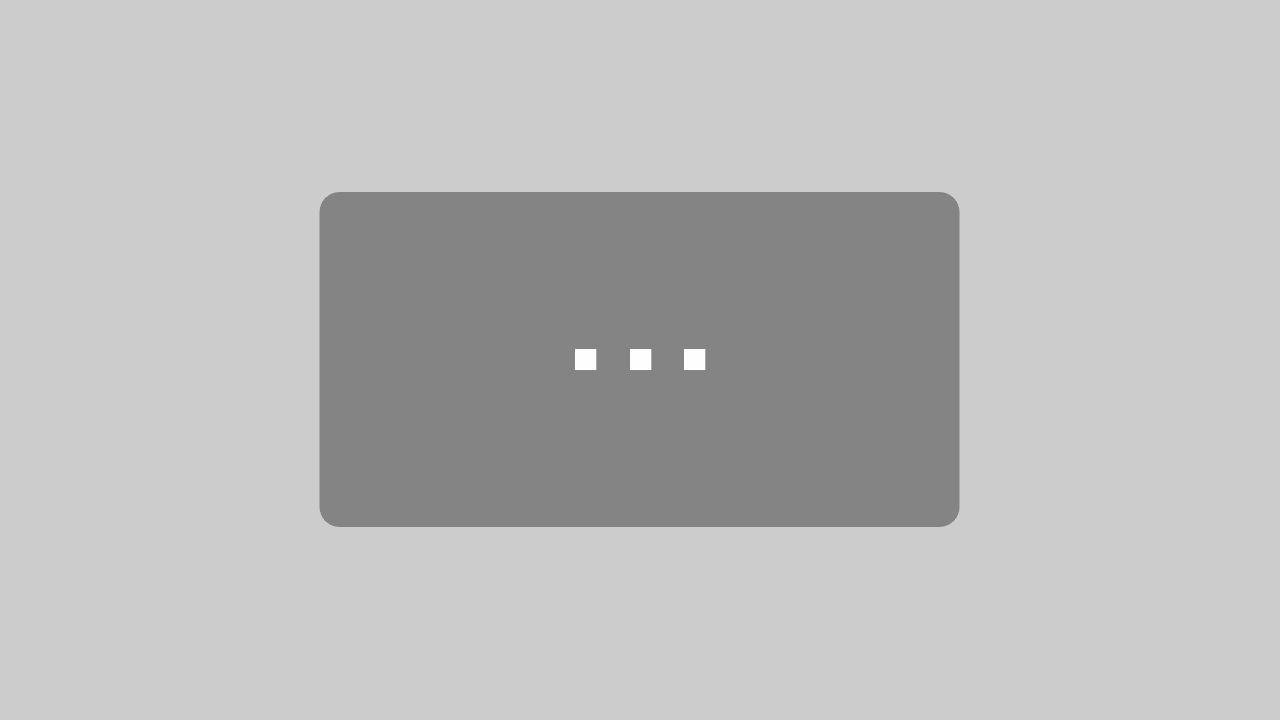Im Interview spreche ich mit Filmemacher und Visionär Joshua Conens über seinen Werdegang und seine kreativen Projekte. Mit seinem aktuellen Film „CaRabA“ tourt Joshua samt Team gerade durch zahlreiche kleine und große Kinos in Deutschland. Im Video erfährst du:
- Wie Joshua als Autodidakt zum Filmemachen kam
- Wie der Film „CaRabA“ entstand und finanziert wird
- Welche Kompetenzen im heutigen Bildungssystem nicht vermittelt werden und welche alternativen Möglichkeiten es gibt
- Wie er Menschen dazu inspirieren möchte, selbstbestimmter zu leben und einfach ihr Ding zu machen
- Und vieles mehr
Joshuas Webseite
Film „CaRabA“
Unter dem Video gibts das Interview auch nochmal zum Nachlesen.
Hallo ihr Lieben! Herzlich willkommen zum neuen Interview. Ich habe heute Joshua dabei, er ist Filmemacher und Visionär – wobei er sich selbst gar nicht auf einen „Beruf“ festlegen kann. Dazu wird er gleich mehr erzählen. Hallo lieber Joshua, schön dass du dabei bist!
Hi Julia, sehr gerne!
Erzähl doch mal kurz wer du bist, wo du lebst und wie gerade dein Alltag aussieht.
Ich bin der Joshua, bin jetzt 32 Jahre alt und lebe in Weimar aktuell. Wobei die Orte für mich vor allem Wohnorte sind – beruflich bin ich immer schon in ganz Deutschland unterwegs. Insofern spielt es nicht so eine große Rolle, wo ich wohne, weil ich dann eh im Auto oder Zug bin und dahingehe wo die Arbeit ist. Meine Arbeit ist sehr vielfältig, deswegen lässt sich das schwer definieren. Weil Arbeit von Anfang an für mich nicht nur als Erwerbsarbeit definiert war, sondern immer klar war: Arbeit ist das, was man beitragen will in der Welt. Manchmal gibts dafür auch Geld, meistens eher nicht – wenn man gute Sachen machen will. Jetzt gerade steht der Film „CaRabA“ sehr im Vordergrund – die größte Filmproduktion, die ich bisher gemacht habe. Ich mache schon seit vielen Jahren Filme. Damit machen wir Veranstaltungen, bewerben den Film und da gibts sehr viele Dinge – weil vor allem die ganzen organisatorischen, finanziellen und rechtlichen Stränge alle bei mir zusammenlaufen. Das ist sehr viel Verwaltungsarbeit, die damit gerade einher geht. Das ist ein Hauptding. Und dann mit meinem 5-jährigen Sohn Zeit zu verbringen – das ist sozusagen die andere große Baustelle gerade.
Zu dem Film kommen wir nachher nochmal ausführlicher. Ich wollte jetzt nochmal kurz deinen Werdegang beleuchten. Du hast ja noch während der Schulzeit angefangen, das ganze System zu hinterfragen. Hast du dein Abi eigentlich noch zu Ende gemacht oder hast du da schon andere Wege eingeschlagen?
Ich hab tatsächlich mein Abi dann nicht gemacht. Die beste Entscheidung, die ich je in meinem Leben getroffen habe. Ich hatte das Pech, ein guter Schüler zu sein und dann gab‘s selbstverständlich die Erwartung, dass man den bestmöglichen Schulabschluss macht. Ich hatte aber so viele grundsätzliche Fragen an das Leben. Was das hier überhaupt alles sollte. Das kam mir alles ziemlich sinnlos vor. Dann gibts aber so vorgefertigte Wege, wo man so eins nach dem anderen abarbeitet, weil man das halt so macht – und kommt darin selber eigentlich überhaupt nicht vor. Ich hatte das Gefühl: Das ist aber doch das Wichtigste, dass ich überhaupt vorkomme in meinem Leben. Und irgendwann muss man damit ja mal anfangen. Für mich spitzte sich das im Abitur so zu, weil da diese Absurdität so auf die Spitze getrieben ist. Ich kann gar nicht sagen warum, aber irgendwie war für mich so klar, dass auch alle anderen wissen: Beim Abitur geht es ja überhaupt nicht darum, dass man irgendwas lernt, was ansatzweise sinnvoll oder für das Leben hilfreich ist. Sondern da gehts nur noch um diesen Schein. So richtig schwarz auf weiß wissen wir das auch als Gesellschaft, aber man macht das halt so, weil man es eben so macht. Und dafür war ich mir irgendwie zu schade und hatte das große Glück, dass es einigen anderen aus meiner Klasse auch so ging. Wir haben uns dann zusammengeschlossen und mit fünf Leuten vor dem Abitur die Schule abgebrochen und selber ein Orientierungsjahr organisiert. Mit einem ganz klaren Rahmen für ein Jahr was wir machen. Wir haben auch zusammen in einer WG gewohnt und dann selber ganz viele Projekte gemacht um rauszufinden, was man mit seinem Leben gerne machen will. Weil uns klar war: Es gibt dafür gesellschaftlich eigentlich überhaupt gar keine Räume für die eigene Planlosigkeit, die ja heute noch viel schlimmer ist als vor 15 Jahren. Und man sich die selber dann bauen muss. Dann haben wir das halt so gemacht. Ich habe ja trotzdem noch automatisch einen Realschulabschluss mitbekommen, aber den hab ich bis heute auch nie gebraucht. Ich hätte gern darauf verzichtet. Im Nachhinein denke ich, ich hätte bessere Sachen machen können, also so einen Realschulabschluss, den ich eh nicht brauche.
Rückwirkend kann man das ja immer besser bewerten. Bei mir war es auch so: Ich war immer gut in der Schule und hab mich durch dieses Abi gekämpft. Ich war aber immer selbstständig und habe weder mein Abi gebraucht noch meinen Bachelor-Abschluss. Noch nie hat mich irgendjemand nach meinen Zeugnissen gefragt. Im Studium ist es ja genau das Gleiche: Du musst diesen Zettel haben, damit du diesen Beruf machen darfst. Ist es denn so, dass dein Leben sich jetzt sinnerfüllter anfühlt?
Das würde ich ganz klar so sagen. Das waren so verschiedene Schlüsselerlebnisse. Den Sinn gebe ich meinem Leben dadurch, dass ich anfange, mein Leben selber in die Hand zu nehmen und überhaupt gestaltend tätig zu werden. Dass ich ja nicht ausgeliefert bin, wie mein Leben zu laufen hat, sondern dass ich ja selber aktiv anfangen kann, mein Leben selber zu gestalten. Und das führte dazu, dass ich gefragt habe: Was will ich eigentlich in meinem Leben? Ich will rauskriegen, was das hier alles soll und etwas beitragen. Das hab ich dann gemacht und seitdem fühlt sich mein Leben ziemlich gut an. Ich hab in den letzten 15 Jahren ziemlich coole Sachen gemacht.
Vor allem viele Sachen! Wie bist du eigentlich zum Filmemachen gekommen?
Das ist eine der längsten Tätigkeiten, die ich mache. Deswegen werde ich damit auch oft verbunden und als Filmemacher bezeichnet. Das hat tatsächlich über ein Theaterprojekt angefangen, das ich noch zu Schulzeiten gemacht habe. So ein theaterpädagogisches Projekt in den Sommerferien zusammen mit anderen Leuten. Mit einer Theaterpädagogin haben wir da Theater gespielt, weil ich da irgendwie Spaß dran hatte. Aus der Truppe haben dann zwei Mädels gesagt: Wir haben Lust, das selber danach noch weiter zu machen. Sie sind dann auf die Idee gekommen, das als Film zu machen, das ist ja unkomplizierter als ein Theaterstück. Weil sie aber keine Ahnung von Technik hatten, haben sie mich und einen Freund da mit reingezogen und gesagt: Ihr müsst mal die Kamera machen. Dann haben wir vom Offenen Kanal eine Kamera in die Hand gedrückt bekommen. Und haben dann in den Sommerferien zwei Wochen lang just for fun einen Spielfilm gedreht, für den die Mädels ein Drehbuch geschrieben hatten. Das hat so viel Spaß gemacht, dass wir das im Jahr darauf wiederholt haben und dann führte eins zum anderen. Dann haben wir gesagt: Jetzt wollen wir mal einen größeren Film machen und dann haben wir 2008 einen zweistündigen Spielfilm gedreht. So hat mich das irgendwie immer begleitet. Wobei ich sagen würde, dass meine Leidenschaft immer bestimmten Themen gilt, an denen ich arbeite und ich nutze dafür verschiedene Medien. Und ein Medium ist eben der Film. Aber meine Leidenschaft gilt nicht dem Medium Film, sondern weil es ein Werkzeug ist das ich ein Stück weit beherrsche, weil ich das jetzt so lange schon mache. Deswegen würde ich nie sagen, dass ich Filmemacher bin. Ich hab an sich kein Interesse daran, Filme zu machen. Bei „CaRabA“ war es naheliegend, um an dieser Thematik zu arbeiten, einen Film zu machen. Vielleicht mache ich auch die nächsten zehn Jahre keine Filme.
Hast du dir das alles selber beigebracht, also die Technik?
Das ist ja mit dem selber beibringen immer so eine komische Sache. Selber beibringen stimmt ja eigentlich nie. Man greift ja immer auf ganz viel Wissen von ganz vielen anderen Menschen zurück. Man lernt ja immer von anderen Menschen. Die entscheidende Frage beim Autodidaktentum ist ja eigentlich: Wie kommt die Beziehung zustande? Ich hab ganz viel von anderen Menschen gelernt, die aus der Branche waren, mit denen ich zusammengearbeitet hab und die ich ausgefragt habe. Ich hab ganz viel im Internet recherchiert, Videos geguckt, Bücher gelesen. Ich habe es in dem Sinne nicht formalisiert gelernt – also ich hab niemals einen offiziellen Kurs besucht, sondern hab die Menschen und die Quellen selber immer gesucht. Insofern würde ich sagen: Ich bin schon konsequenter Autodidakt und habe Institutionen gemieden wo ich nur konnte.
Wenn du jetzt einen Filmstudenten treffen würdest, gäbe es da einen Konflikt? Nach dem Motto: Du nennst dich einfach Filmemacher und machst das und ich muss fünf Jahre studieren?
Das müsstest du natürlich die Filmstudenten fragen (lacht). Ich hab das Gefühl, dass die Filmbranche da auch sehr angenehm ist, weil da Abschlüsse tatsächlich wenig eine Rolle spielen. Du hast halt Referenzen – also Filme, die du schon gemacht hast. Das find ich auch immer so absurd. Bei „CaRabA“ waren am Ende über 400 Menschen beteiligt. Da habe ich mir von niemandem ein Zeugnis angeguckt. Wenn man selber mit anderen Leuten zusammen arbeitet, merkt man erstmal, wie dumm das eigentlich ist – die Vorstellung, dass das irgendwie helfen würde, das Schulzeugnis von jemandem anzugucken, um einzuschätzen ob derjenige gut ist für eine Zusammenarbeit. Insofern spielt es da tatsächlich eine sehr geringe Rolle und ist auch sehr durchmischt. Da gibt es viele Autodidakten, natürlich auch Leute, die das studiert haben. In meiner Wahrnehmung war das nie ein Konflikt. Obwohl man natürlich auch sagen muss, dass ich mit der Filmbranche auch nicht so viel zu tun habe, weil ich nie den Anspruch hatte, dazuzugehören.
Reicht das Filmemachen für deinen Lebensunterhalt?
Gerade ist das Filmemachen meine Haupteinnahmequelle, aber durch Auftragsfilme die ich dann mache. Aber das schwankt auch sehr, weil ich das auch nicht Vollzeit mache und das ein Baustein ist neben ein paar anderen. Aber jetzt gerade finanziert mich das.
Wenn das Geld, das über die Filme reinkommt, nicht reicht – was würdest du dann noch für Jobs machen?
Ich hab auch schonmal im Supermarkt an der Kasse gesessen oder Pizza ausgefahren oder Messebau-Nachtschichten gemacht. Wenns sein muss, mache ich auch sowas. Ansonsten ist das gar nicht so einfach zu sagen, weil es sich sehr zusammen puzzelt. Natürlich versuche ich schon immer, mich über die Projekte zu finanzieren, die ich mache. Zum Beispiel die Berufswege-Portraits oder Schenkgeld-Experimente. Das sind aber eher so idealistische Projekte, die dem Gemeinwohl dienen – damit kann man ja kein Geld verdienen im Kapitalismus. Deswegen ist es nie so, dass ich davon allein leben könnte. Und ich hab ja auch ein paar Menschen, die mir regelmäßig Geld schenken, damit ich diese Arbeit so machen kann.
„Den Sinn gebe ich meinem Leben dadurch, dass ich anfange, mein Leben selber in die Hand zu nehmen und überhaupt gestaltend tätig zu werden.“
Hast du in deinem Kopf eine Vision von einer Welt, wo jeder sein Potenzial voll ausleben kann und damit auch seinen Lebensunterhalt bestreiten kann?
Hm. Nee. Das ist ein Aspekt den ich sehr schätze am Grundeinkommen – neben anderen, die ich auch kritisch sehe – dass ich sehr für eine Trennung von Arbeit und Einkommen bin. Das finde ich sehr naheliegend, dass jeder Mensch erstmal leben können muss und dann kann er arbeiten. Also in dem Sinne finde ich es kein Ideal, dass man von dem was man macht leben kann. Denn leben muss man ja so oder so. Es muss Rahmenbedingungen geben, so dass jeder in Würde leben kann und erst dann stellt sich die Frage: Was will ich eigentlich machen? Und so begreife ich auch meine Arbeit. Dass meine Arbeit immer ein Geschenk ist, weil man Arbeit nicht bezahlen kann. Das ist doch mit gesundem Menschenverstand eine absurde Vorstellung, dass man Arbeits bezahlen könnte. Dann werde ich ja zum Sklaven. Meine Arbeit ist immer geschenkt. Auch bei den Menschen, die bei „CaRabA“ mitgewirkt haben. Dann bezahle ich sie doch nicht, sondern versuche einen Beitrag zu leisten, dass sie in Würde leben können. Idealerweise macht man daraus keine Hierarchie.
Wenn es ein Grundeinkommen gäbe und du genug Geld zu Leben hättest, würdest dann noch die gleichen Projekte machen?
Man kann ja auch heute schon so leben wie mit Grundeinkommen. Ich habe mein Leben lang immer genau die Sachen gemacht, die ich machen wollte. Mit Grundeinkommen würde sich überhaupt nichts an meinem Leben ändern. Ich würde genau dasselbe machen. Der einzige Unterschied sind die Auftragsfilme, auch wenn das alles ziemlich coole Sachen sind wo ich wirklich dahinter stehe und es auch in der Zusammenarbeit Spaß macht. Aber das sind nicht ganz meine Herzensanliegen und wenn ich auf das Geld nicht angewiesen wäre, würde ich einige Projekte nicht machen. Sondern mich voll auf die großen Projekte fokussieren, wie jetzt „CaRabA“.
Hast du dieses Filmprojekt initiiert?
Ganz ursprünglich ging das los mit Bertrand Stern, einem Philosophen, der sein ganzes Leben lang schon an dem Thema Bildung arbeitet. Er hatte eines Tages die Idee, einen Film zu machen, den es so noch nicht gibt, um die Frage nach nicht institutionalisierter und freier Bildung greifbarer zu machen. Der schrieb mir eines Tages eine Email, dass er da so eine Idee hat und ob ich nicht Lust hätte, das mit ihm zu machen. Da habe ich dann leichtfertig ja gesagt (lacht). So kam das eigentlich zustande.
„Meine Arbeit ist immer ein Geschenk, weil man Arbeit nicht bezahlen kann.“
Es war ja dann doch ein sehr großes Projekt. Wie lange habt ihr insgesamt für die Produktion gebraucht?
Die Email bekam ich im März 2014 – also vor fünfeinhalb Jahren ungefähr. Und dann haben vor allem die Vorbereitungen ziemlich viel Zeit gebraucht, weil es sehr komplex war, mit einem Philosophen die inhaltlichen Vorgaben in ein Drehbuch zu bringen. Wir hatten auch einen Drehbuchautor und haben erstmal drei Jahre lang inhaltlich-strukturell an dem Drehbuch gearbeitet. Der Dreh war 2017. Im Sommer/Herbst haben wir sieben Wochen daran gedreht. Dann noch die ganze Postproduktion und Schnitt. Seit Mai 2019 ist der Film in der Welt und in den Kinos und wir touren herum.
Wie hat sich denn das Projektteam zusammen gefunden? Gab es da Ausschreibungen?
Sehr unterschiedlich, wie halt das Leben so spielt. Den Autor kannte ich schon, da wir uns schon ein paar Mal über den Weg gelaufen waren. Ich wusste, dass er schreibt und er wusste, dass ich Filme mache und wir hatten so gesagt: Naja, vielleicht ergibt sich ja irgendwann mal was. Und bei dem Projekt dachte ich dann an ihn und dann haben wir uns zusammen gesetzt und irgendwie passte das dann. Mit der Regie war es sehr sehr schwierig. Ich hab mir sehr sehr viele Regisseurinnen und Regisseure angeschaut und da auch Ausschreibungen gemacht. Tatsächlich ist die Katharina Mihm, die dann bei „CaRabA“ Regie geführt habt, über irgendeine Ausschreibung an der Filmhochschule darüber gestolpert und hatte sich dann gemeldet. Und dann hat das gleich sehr gut gepasst. Vieles lief über Mundpropaganda.
Kannst du nochmal ganz kurz die Handlung des Films umreißen?
„CaRabA“ zeigt eine Welt, die es so nicht gibt, in der es keine Schulen mehr gibt. Und zwar als Gesellschaft, also nicht individuell – es gibt einfach als Gesamtgesellschaft keine Schule mehr, weil die allgemeine Schulpflicht aufgehoben wurde. Es werden dann fünf ganz unterschiedliche Geschichten erzählt von jungen Menschen und gezeigt, was die dann den Tag über so machen. Womit sie dann konfrontiert sind und was dann so passiert. Das war eben der Ansatzpunkt, ein Abbild der Gesellschaft – das ist ja immer sehr fragmentarisch – sichtbar zu machen. Das finde ich das interessante am Medium Film: Das man doch sehr konkret etwas darstellen kann, was noch nicht ist. In den Überlegungen am Anfang war das ein Ausgangspunkt, dass wir uns als Gesellschaft ja einig sind, dass Schule schlecht ist so wie sie ist – aber es doch sehr wenig Visionen oder überhaupt gesellschaftliche Räume gibt, in denen visioniert werden kann: Was wäre denn das, was wir uns eigentlich für unsere Kinder oder die jungen Menschen wünschen? Und es war die Frage: Wie könnte man das anregen, diese Räume eigentlich zu schaffen. In dem Sinne geht es überhaupt nicht darum, dass das jetzt das Nonplusultra wäre. Sondern eigentlich geht es darum, die eigenen Visionskräfte anzuregen: Wie könnte es denn eigentlich sein? Können wir uns überhaupt etwas anderes vorstellen, als das bestehende Schulsystem?
Ihr habt ja dann auch eine Filmtour gemacht, wo es auch immer Diskussionsrunden gab. Konnten alle Zuschauer was mit dem Film und der Botschaft anfangen?
Das ist natürlich – wie es ja auch sein soll – sehr kontrovers. Das war ja auch das Ziel. Und es dauert ja noch an, wir haben auch jetzt im Herbst wieder ziemlich viele Veranstaltungen. Was ich sehr interessant finde, dass schon von Anfang an – also schon beim Drehbuch, das ich mit vielen Leuten diskutiert habe – zwei Extreme entstanden, die auseinander gehen. Die eine Rückmeldung ist: Das wäre ja gar keine Vision, denn das ist total traurig und alle sind so vereinzelt und haben ganz viele Probleme – das wäre alles so trostlos. Und dann gibts noch die andere Seite die sagt: „Das ist ja alles total idealisiert – so eine schöne Welt kann es ja gar nicht geben. Die Erwachsenen sind alle so freundlich und offen und nehmen sich so viel Zeit für die Kinder. Das ist alles so unbeschwert.“ teilweise auch innerhalb einer Diskussion, dass einer es so empfindet und der andere sagt: Ich hab das genau andersrum wahrgenommen. Wo ich daraus schließen kann: Es hat viel mit der eigenen Sicht auf das Thema zu tun, das kann dann nicht mit dem Film selber zu tun haben. Gerade bei dem Thema Schule gibt es so viele vorgefertigte Meinungen. Je nachdem, mit welcher Haltung man in den Film reingeht, sieht man den Film so oder so und versucht, seinen eigenen Blick zu bestätigen. Für mich ist es kein Propaganda-Film, weder für die eine noch für die andere Sache. Wir haben uns von Anfang an sehr sehr viel Mühe gegeben, niemanden überzeugen zu wollen oder sagen zu wollen, was richtig und was falsch ist. Sondern eher einen Raum zu öffnen. In der Regel ist es aber irgendwo im Mittelfeld. Gerade die Menschen, die noch nicht so eine vorgefertigte Meinung haben – hab ich den Eindruck – fühlen sich eingeladen, darüber nachzudenken. Wofür die Gespräche nach der Filmvorführung natürlich super sind und total viel Spaß machen. Gemeinsam zu überlegen: Was bräuchte es denn und wie könnte es denn eigentlich sein?
Arbeitet ihr auch mit anderen Initiativen zu diesem Thema zusammen?
Teilweise auch das. Es gibt ja immer wieder Veranstaltungen, die in Kooperation stattfinden oder auch Schulen, die den Film zeigen und dann darüber diskutiert wird. Grundsätzlich reden wir ja mit fast jedem, weil es immer interessant ist. Trotzdem ist unser Ansatz jetzt nicht, mit Entscheidungsträgern zu reden, sondern mit dem Publikum beim Film.
Das ist ja auch das Wichtigere, erstmal die Gedanken dafür zu öffnen und ein Umdenken anzuregen. Die ganze Bewegung von unten anzufangen.
Genau, das ist meine Grundhaltung. Dass Veränderung ja immer mit einzelnen Menschen anfängt.
Dieses ganze Modell, Bildung neu zu denken bzw. den Kindern mehr Freiraum zu geben setzt ja sehr viel Vertrauen von den Eltern voraus. Was denkst du, warum es vielen so schwer fällt, Vertrauen in ihre Kinder zu haben und sie denken, man müsse Wissen vorsetzen, damit aus dem Kind „was wird“?
Das ist natürlich jetzt viel Spekulation. Wenn ich mir mein eigenes Leben anschaue gibts viele Themen an der Oberfläche und tieferliegend hat es damit zu tun, was die eigene Vorstellung vom Leben ist. Das ist für mich eine der Hauptfragen, an der ich die letzten 15 Jahre forsche. Weil es so ein oberflächliches Selbstverständnis davon gibt, was eben Leben ist. Leben ist: Zur Schule gehen, zur Uni gehen, zur Arbeit gehen, Rente. Das heißt: Miete zahlen, in die Rentenkasse einzahlen und was da alles an Konventionen dazugehören, was eben das Leben ausmacht. Und dann hat man freie Zeit, da kann man sich dann besaufen oder Freunde treffen oder ins Kino gehen. Ich nehme aber wahr, dass es noch eine andere Perspektive auf das Leben gibt, die nicht so an den Äußerlichkeiten hängt, sondern die von innen getragen wird. Ich hab viel zum Thema Berufsorientierung mit Jugendlichen gearbeitet und da gibt es auch so eine große Angst und dann frag ich mich manchmal: Wovor eigentlich? Weil wir ja hier so sicher leben, wie kaum irgendwo sonst auf der Welt. Es gibt ja real viele Menschen, die tatsächlich ein Problem haben, wenn sie am Tag nicht ein paar Dollar zusammenkriegen, um sich abends eine warme Suppe zu kaufen. Ich hab einfach die Gewissheit, dass ich nicht obdachlos sein werde und dass ich nicht hungern muss. Und dann frage ich mich: Woher kommt eigentlich die Angst? Dann kann ich doch mit einem großen Vertrauen in die Welt gehen: So schnell passiert mir ja nichts. Wir haben ja sogar ein Sozialsystem, dass einen mit Hartz4 auffängt. Nicht, dass ich jetzt Hartz4 gutheißen wöllte, aber es ist ein Sicherungsnetz, das es gibt. Und dann merkt man, dass wir oft das Leben sehr äußerlich begreifen: Das schlimmste was mir passieren kann, ist, mein Haus zu verlieren oder all die tollen Sachen nicht mehr kaufen kann. Für mich ist die größte Angst, mich selber zu verlieren. Das kann man aber nicht denken, sondern nur fühlen und das ist ja das interessante: Warum manche Menschen das existenziell fühlen und andere nicht? Das ist eine der großen Fragen, die ich habe. Dann verändert sich die Perspektive auf das Leben. Weil ich dann ganz neu die Frage stellen kann: Was ist eigentlich wichtig im Leben? Ich hatte immer das Gefühl von: Ich will es wenigstens so weit ausprobieren, wie es geht. Ich hab nie das Gefühl, dass das jetzt funktionieren muss. Das war auch für „CaRabA“ ganz wichtig. Es heißt ja nicht, dass man dann äußerlich glücklicher ist und nur noch lachend durch die Welt läuft – sondern man hat ganz schön viele Probleme, auch als Autodidakt. Aber es ist erfüllter und ich habe das Gefühl: Es ist MEIN Leben. Ich wüsste niemanden, mit dem ich gern mein Leben tauschen wöllte, weil ich das Gefühl hab: Ich lebe das beste Leben, das ich leben kann. Ich bin sehr dankbar für alles, was ist und wüsste nicht, was man mehr will vom Leben. Ich versuche so konsequent es geht das Leben zu leben was ich leben will. Da wo es nicht geht, finde ich Kompromisse. Aber ich kann zumindest immer von mir sagen: Ich habs versucht. Also auch einfach mal als Jugendlicher was auszuprobieren, irgendeinen total absurden Beruf. Man kann es doch ausprobieren! Und wenn es nicht klappt, kannst du mit 35 immer noch Abitur machen und studieren.
„Ich versuche so konsequent es geht das Leben zu leben was ich leben will.“
Aber dann müssten die Eltern oder die Lehrer dafür offen sein und das Vertrauen haben. Denn wenn das Kind jeden Tag diese Panikmache mitbekommt, traut es sich ja gar nicht, einfach mal etwas ausprobieren.
Am Ende ist es ganz viel Vertrauen und die eigenen Vorstellungen, die man auf seine Kinder projiziert. Es ist ja klar, dass man als Eltern auch Ängste hat. Aber es ist die Frage: Muss man die auch immer gleich ungefiltert an seine Kinder weitergeben oder kann man die auch selber in sich bearbeiten? Das ist am Ende natürlich auch die Frage nach einer irgendwie spirituell gearteten Praxis – was auch immer das dann konkret heißt, das kann ja sehr unterschiedlich aussehen. Dass man mit seinen eigenen Ängsten und Gefühlen bei sich bleiben kann. Das ist etwas, was ich aus meiner Kindheit mitgenommen habe: Dass meine Mutter das konnte. Diese Ängste, die sie sicherlich auch hatte, für sich zu behalten und mir sehr viel Vertrauen zu schenken, dass es schon irgendwie gut gehen wird. Am Ende ist ja nicht entscheidend, ob SIE glücklich ist mit meinem Leben, sondern ob ICH glücklich bin mit meinem Leben. Da reden immer alle von Liebe – aber von was für einem Liebesbegriff gehen wir da eigentlich aus? Gehts da eigentlich um den anderen oder um mich? Was ja auch OK ist. Aber wenn das überhaupt nicht reflektiert ist, wird es natürlich schwierig für die Kinder. Trotzdem stellt sich natürlich auch die Frage – auch für mich als jungen Menschen war es die Frage: Geht es eigentlich darum was meine Eltern wollen, oder geht es um MICH? Also auch da braucht es irgendwann die Abnabelung, um zu sagen: Moment mal, das ist ja MEIN Leben und vielleicht ist es viel entscheidender was ICH mit meinem Leben machen will. Was für mich immer klar war, also auch meine Abitur-Entscheidung: Das hängt ja nicht von meinen Eltern ab. Sondern das ist meine Entscheidung, denn ich trage ja auch die Konsequenzen dafür. Natürlich war mir das ein Anliegen, dass meine Eltern das auch gut finden und mittragen. Aber es war für mich von Anfang an klar, dass ich meine Entscheidung davon nicht abhängig mache.
Aber ich glaube, da ist auch grad viel in Bewegung. Unsere Generation denkt ja schon viel offener über diese Themen nach, als noch unsere Eltern.
Obwohl es auch interessant ist, auch da mal zu schauen, wie die Biografien eigentlich verlaufen sind. Weil die oft auch gar nicht so gerade sind, wie einem das so vorgegaukelt wird. Auch in der Schule wird einem immer so von geradlinigen Lebensläufen erzählt, aber wenn man im Detail nachfragt sind die selten so. Also auch das ist eine Vorstellung vom Leben, die mit dem Leben selber gar nicht so viel zu tun hat.
Wie habt ihr den „CaRabA“-Film denn eigentlich finanziert? Wie habt ihr die Kosten gedeckt?
Das wüsste ich auch gerne (lacht). Bisher noch nicht. Der Bertrand Stern hat eine Stiftung durch eine Erbschaft gegründet und hat eigentlich das gesamte Stiftungskapital in diesen Film investiert. Das war sozusagen der Startschuss, ansonsten hätte ich mich da auch nicht drauf eingelassen. Somit war klar: Es gibt einen Startschuss, der zwar nicht reichen wird, aber es ist schonmal Geld da. Einige Stiftungen und weitere Akteure haben auch noch Geld reingesteckt. Und dann gab es ja ein großes Crowdfunding, das wir gemacht haben vor einem Jahr, wo auch nochmal sehr viel Geld zusammen kam, um die ganze Postproduktion zu finanzieren. Jetzt haben wir immer noch ein sehr großes Defizit von der Herstellung des Films. Wobei man sagen muss: Den Film überhaupt so günstig produzieren zu können ging nur, weil die Menschen überwiegend ehrenamtlich mitgearbeitet haben. Die haben alle andere Jobs nebenbei gemacht, um an diesem Projekt mitwirken zu können. Weil sie aus idealistischen Gründen dahinterstanden. Wir müssen jetzt über die Veranstaltungen und DVD-Verkäufe einige tausend Euro wieder reinbringen, damit ich nicht am Ende auf dem Geld sitzen bleibe.
Also hast du auch ehrenamtlich dafür gearbeitet?
Genau. Es gab auch immer mal ein bisschen Geld, aber das war eher im Sinne von Aufwandsentschädigung. Ich hab viele Wochen lang 60 Stunden pro Woche dran gearbeitet und maximal 400 Euro bekommen. Das ist dann eher symbolisch. Mir war es wichtig bei den Leuten, die richtig lange daran gearbeitet haben, ihnen symbolisch ein bisschen was zu geben.
Aber es ist ja schon so, dass man seine Existenzangst da irgendwie ausschalten muss, wenn man monatelang nichts reinbekommt. Wie hast du das im Kopf für dich klargekriegt?
So ist es ja schon mein ganzes Leben. Das ist ja das Schöne, wenn man früh damit anfängt. Als junger Mensch ist es ja einfach, mit sehr wenig Geld zu leben. Und dann hat man die Gewissheit: Irgendwie wird es gehen. Es sind natürlich verschiedene Faktoren. Ich konnte mir in meiner Verwandschaft schon immer zinslos Geld leihen – das habe ich immer mal wieder gemacht und es später zurückgezahlt. Bei „CaRabA“ hatte ich das Glück, dass auch mit Auftragsfilmen nebenher ziemlich viel lief, dass ich es dann so irgendwie hinbekommen habe.
Hast du neue Projekte geplant oder bist du erstmal noch mit „CaRabA“ beschäftigt?
Ich bin mit dem Film immer noch voll ausgelastet, mit Veranstaltungen und was da noch alles dranhängt. Auch die ganze administrative Abwicklung, Buchhaltung, Steuererklärung usw. In der Größenordnung ist es eigentlich auch ein Projekt, wo man mindestens fünf Vollzeitkräfte bräuchte und wir machen das mit so zweieinhalb bis drei Leuten, die alle ehrenamtlich auch noch andere Sachen machen. Deswegen wird mich das das nächste halbe Jahr noch sehr beschäftigen. Und dann eben mit unserem Sohn, zu fragen: Wie baut man neue Strukturen. Das beschäftigt mich ja mein Leben lang schon. Dass man als Autodidakt ja doch ein bisschen rausfällt, weil es dafür keine Strukturen gibt in unserer Gesellschaft und alles strukturell auf Institutionen aufbaut. Ich hab schon sehr früh damals in Witten im Ruhrgebiet, wo ich aufgewachsen bin und später in Berlin, wo ich lange gelebt habe, angefangen, freie Bildungsräume zu bauen. Aus meinem eigenen Bedürfnis und die dann aber auch zu öffnen für andere. Und das wird auch nochmal interessant im Hinblick auf unseren Sohn – also das auch für jüngere Menschen zu öffnen und da Strukturen und Angebote zu bauen, die unabhängig sind von den bestehenden Institutionen. Ganz langfristig läuft es wahrscheinlich darauf hinaus, dass ich so etwas wie ein Orientierungsjahr für junge Menschen anbieten werde. Da arbeite ich eigentlich im Hintergrund seit 12 Jahren dran – Vorrecherchen und verschiedene Bausteine zusammen zu setzen.
Also du würdest dieses Orientierungsjahr dann begleiten?
Genau.
Vielen Dank, Joshua, für dieses inspirierende Interview. Ganz viel Erfolg weiterhin mit deinen Projekten!
Werde zur Onlinebusiness-Heldin: Dein All-in-1 Programm zum Businessaufbau
Der umfassende Onlinekurs für deinen nachhaltig erfolgreichen Businessaufbau – Von der lukrativen Businessidee bis zur glasklaren Positionierung, attraktiven Angebotspalette, Preisfindung, Money Mindset, Aufbau deiner Marke, sowie authentischem und empathischem Marketing.